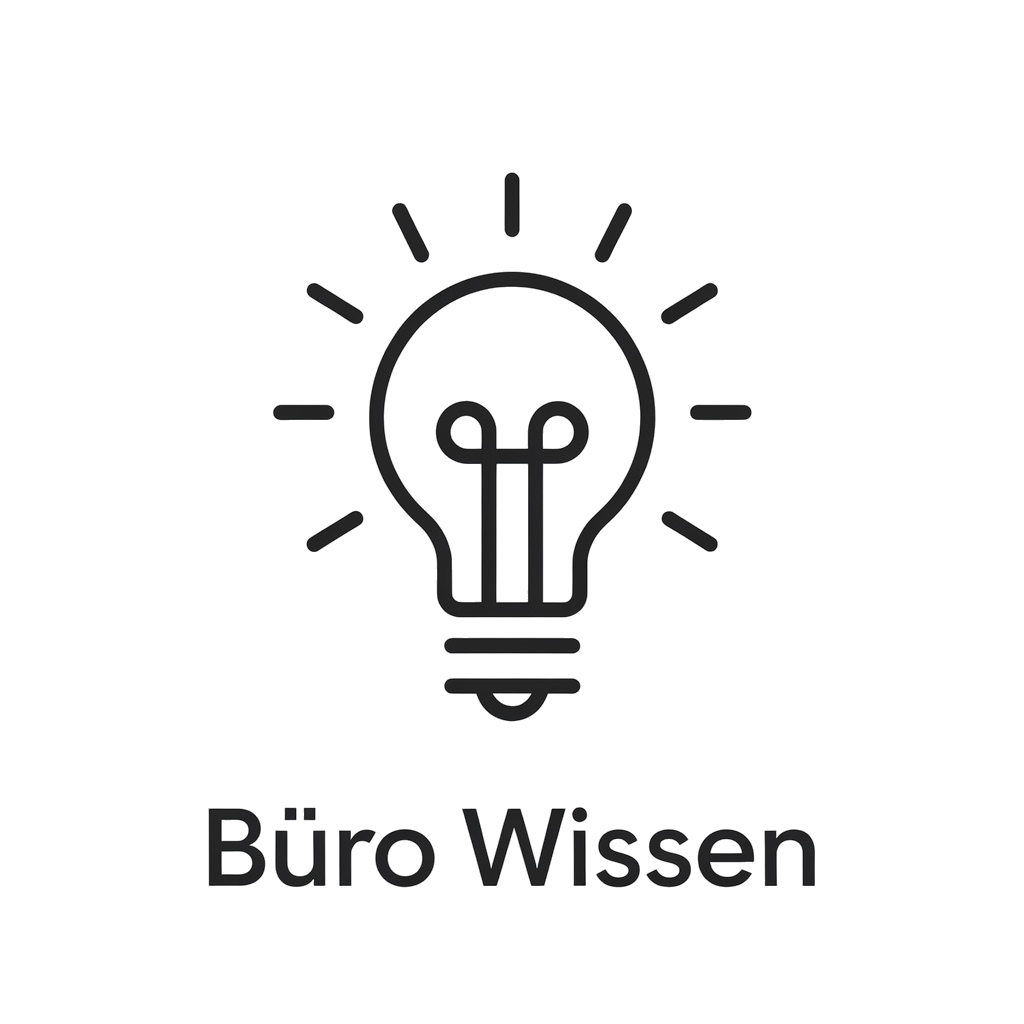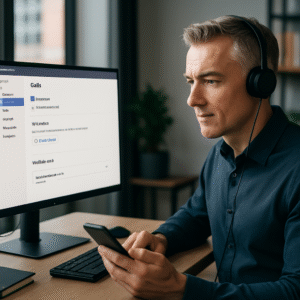Moderne Arbeitswelten verlangen nach mehr als nur Großraum oder Einzelbüro. Das Kombibüro bietet eine durchdachte Antwort auf die Frage: Wie kann man konzentriertes Arbeiten und spontane Teamkommunikation unter einem Dach vereinen?
In diesem Beitrag tauchen wir tief in das Konzept des Kombibüros ein – wir zeigen dir, was es ausmacht, welche Vorteile und Herausforderungen es gibt, und was du bei Raumgröße, Ausstattung, Lärmschutz, Ergonomie und rechtlichen Vorgaben beachten musst. Dabei berücksichtigen wir sowohl die gesetzlichen Anforderungen als auch die typischen Fragen aus der Praxis – zum Beispiel zur idealen Größe, zur Datensicherheit oder zur sinnvollen Aufteilung von Rückzugs- und Kommunikationszonen.
Den kompletten Überblick aller Büroformen gibt es: Büroformen im Vergleich: Welcher Bürotyp passt zu deinem Unternehmen?
Was ist ein Kombibüro? Aufbau und Idee dahinter
Das Kombibüro ist ein hybrides Bürokonzept, das die Stärken zweier Welten vereint: Es kombiniert abgeschlossene Einzel- oder Zweierbüros (häufig entlang der Fensterfassade) mit einem zentralen offenen Bereich, der für Meetings, Teamarbeit und informellen Austausch gedacht ist. Diese offene Zone dient als kommunikatives Zentrum, während die kleinen Einzelräume Rückzug, Ruhe und Vertraulichkeit ermöglichen.
In der Praxis sieht das oft so aus: Eine Etage mit einem Ring aus Kleinstbüros, innenliegend eine offene Fläche mit Besprechungsinseln, Lounges oder Projektarbeitsplätzen – ein klar zoniertes Layout, das Konzentration und Kommunikation räumlich trennt.
Der Begriff „Kombibüro“ steht dabei nicht für ein starres Konzept, sondern für eine flexible Raumstruktur, die sich an die Bedürfnisse des Teams anpassen lässt. Ob als dauerhafte Lösung oder als Teil eines Activity-Based-Working-Konzepts – das Kombibüro steht für strukturierte Offenheit.
Flächenbedarf und Raumgröße im Kombibüro
Ein häufig diskutierter Punkt ist die Größe eines Kombibüros. Wie viel Platz benötigt man für ein solches Konzept – und welche Vorgaben gelten eigentlich?
Zunächst gilt: Das Kombibüro besteht aus zwei Zonen mit unterschiedlichen Anforderungen – den Einzel- oder Zweierbüros („Zellen“) und den offenen Gemeinschaftsflächen. Beide müssen arbeitsstättenrechtlich korrekt geplant sein.
Einzelbüros: Mindestmaße laut ArbStättV
In den kleinen abgeschlossenen Büros gilt laut Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) eine Mindestfläche von 8 m² pro Arbeitsplatz. Kommt eine zweite Person hinzu, sind weitere 6 m² nötig. Ein Zweierbüro sollte also mindestens 14 m² groß sein, exklusive Verkehrsfläche.
Wichtig: In der Praxis werden die Zellen im Kombibüro oft sehr kompakt gehalten – teilweise mit nur 6–8 m² pro Raum. Das ist nur zulässig, wenn dort kein vollwertiger Bildschirmarbeitsplatz dauerhaft genutzt wird (zum Beispiel bei gelegentlichen Rückzugsräumen oder Beratungsplätzen). Für tägliches Arbeiten ist eine Grundfläche von 8–10 m² pro Person verpflichtend.
Offene Zone: Richtwert wie im Großraumbüro
Die zentrale Kombizone in der Mitte funktioniert wie ein kleiner Großraum – dort gelten ähnliche Flächenrichtwerte wie bei offenen Arbeitsplätzen. Als Faustregel gilt:
- 12 bis 15 m² pro Arbeitsplatz, je nach Möblierung und Arbeitsweise
- Zusätzliche Fläche für Verkehrswege, Akustikzonen und Aufenthaltsbereiche
Das ergibt in Summe einen höheren Flächenbedarf als bei reinen Großraumbüros – doch der Mehrwert liegt in der klaren Trennung: konzentrierte Arbeit in ruhiger Umgebung und teamorientierte Kommunikation in der offenen Zone.
Fazit zur Größe:
Das Kombibüro ist flächenintensiv, aber auch nutzungsoptimiert. Die getrennten Bereiche lassen sich effizient belegen, wenn klug geplant wird. Der zusätzliche Platzbedarf zahlt sich durch bessere Arbeitsbedingungen und höhere Zufriedenheit aus – was wiederum Produktivität und Gesundheit fördert.
Belichtung und Sichtverbindung im Kombibüro
Ein Kombibüro lebt von der Kombination aus transparenter Gestaltung und natürlicher Belichtung. Gerade weil Einzelräume und offene Zonen eng verzahnt sind, spielt das Tageslicht eine zentrale Rolle – nicht nur für Wohlbefinden, sondern auch aus rechtlicher Sicht.
Fensterplatz für alle? ArbStättV §3.4 sagt: möglichst ja.
Die Arbeitsstättenverordnung schreibt klar vor: Alle Arbeitsräume sollen möglichst Tageslicht und eine Sichtverbindung nach außen haben. In klassischen Zellenbüros ist das meist durch Fenster an der Fassade gewährleistet. Im Kombibüro wird dieser Vorteil strategisch genutzt: Die Bürozellen werden entlang der Außenwände angeordnet, um jedem Mitarbeiter direkten Zugang zum Tageslicht zu ermöglichen.
Was ist mit der Mittelzone?
Die offene Gemeinschaftsfläche im Zentrum des Kombibüros liegt oft weiter vom Fenster entfernt – ein Planungsproblem, das clever gelöst werden muss. Typische Maßnahmen:
- Verglaste Wände der Einzelbüros zur Mittelzone hin – sie lassen Licht „hindurchfließen“.
- Transparente Trennwände oder sogar teilverglaste Türen – so wird der Blick ins Freie auch aus der Mitte möglich.
- Oberlichter oder Lichtkuppeln – primär in Gebäuden mit großem Grundriss.
- Lichtlenksysteme oder helle Innenausstattung, um das natürliche Licht besser zu verteilen.
Wichtig: Auch arbeitspsychologisch ist ein Fensterblick relevant – das visuelle Erfassen des Außenraums wirkt stressreduzierend und hilft der Orientierung.
Künstliche Beleuchtung: Pflicht in der Tiefe
Wenn die Mittelzone dennoch nicht genug Tageslicht abbekommt, muss künstlich nachgeholfen werden – aber bitte richtig. Laut ASR A3.4 gilt:
- 500 Lux Beleuchtungsstärke am Bildschirmarbeitsplatz
- Blendfreiheit und gleichmäßige Lichtverteilung
- Individuell steuerbare Leuchten, wo möglich
Gerade im Kombibüro ist es sinnvoll, die Beleuchtung flexibel und zonenweise steuerbar zu machen – zum Beispiel per Präsenzmelder oder Tageslichtsensorik.
Lüftung und Raumklima im Kombibüro
Ein gutes Raumklima ist das Rückgrat gesunder Büroarbeit – und im Kombibüro ist das gleich doppelt herausfordernd: Denn es treffen geschlossene Kleinstbüros und offene Gemeinschaftszonen aufeinander, die beide unterschiedliche Anforderungen an Frischluft, Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben.
Zwei Raumtypen, zwei Klima-Welten
- In den Bürozellen: Kleine, oft vollverglaste Räume neigen bei geschlossener Tür zu schneller Erwärmung oder Luftstau. Hier müssen Fensterlüftung oder mechanische Lüftungssysteme für kontinuierliche Frischluft sorgen. Wenn keine Fenster vorhanden sind, greift die ASR A3.6 – sie schreibt ausreichende Lüftung durch raumlufttechnische Anlagen (RLT) vor. Tipp: Überströmelemente an Türen oder Oberlichter helfen, den Luftaustausch mit der zentralen Zone sicherzustellen.
- In der offenen Zone: Hier gelten dieselben Richtwerte wie im Großraumbüro – insbesondere ein CO₂-Gehalt von unter 1000 ppm und eine Raumtemperatur unter 26 °C sind Pflicht (bei leichten Bürotätigkeiten). Besonders an heißen Tagen oder bei hoher Belegung muss die Klimatisierung so ausgelegt sein, dass der Komfort auch dann gewährleistet ist.
Zonenklima? Möglich, aber sensibel
Ein Vorteil des Kombibüros ist die potenzielle Zonierung des Raumklimas: Einzelne Büros lassen sich individuell heizen oder kühlen, während der Open-Space zentral geregelt wird. Das schafft Flexibilität – erfordert aber klare Planung, damit es nicht zu Kälte-/Wärmezonen-Konflikten kommt.
Besonderheiten in der Praxis
- In kleinen Zellenräumen können Luftqualitätsprobleme schneller auftreten – hier sind regelmäßige Stoßlüftungen oder automatische Lüfter mit CO₂-Sensor sinnvoll.
- In der offenen Zone muss Luftzirkulation gewährleistet sein – durch Deckenlüfter, Luftauslässe oder Akustikdecken mit integrierter Belüftung.
- Bei Mischlüftung (Fenster + Technik) muss eine Balance gefunden werden: Zugluft vermeiden, aber Frischluft sichern.
Fazit: Im Kombibüro verlangt das Raumklima doppelte Aufmerksamkeit – denn beide Zonentypen müssen gleichwertig gesund sein. Arbeitgeber sollten hier gezielt messen, regeln und in der Gefährdungsbeurteilung dokumentieren, wie das Klima in Zellen und Zonen jeweils bewertet und optimiert wird.
Lärmschutz und Raumakustik im Kombibüro
Ein Kombibüro soll das Beste aus zwei Welten vereinen – Ruhe durch geschlossene Büros, Austausch durch offene Flächen. Doch genau diese Mischung stellt besondere Anforderungen an den Lärmschutz und die akustische Gestaltung.
Zwei Akustiksysteme unter einem Dach
- In den Einzel- oder Kleinstbüros herrscht meist Ruhe – vorausgesetzt, die Schallschutzmaßnahmen stimmen. Hier gilt: Türen und Wände sollten mindestens den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. Das bedeutet: Schalldämmwerte von 30 bis 37 dB oder mehr, je nach Nutzung. Nur dann können konzentrierte Tätigkeiten oder vertrauliche Gespräche störungsfrei durchgeführt werden.
- In der offenen Gemeinschaftszone hingegen gelten die gleichen Regeln wie im Großraumbüro: Die technische Regel ASR A3.7 empfiehlt einen maximalen Schalldruckpegel von 55 dB(A) für geistige Tätigkeiten. Dafür braucht es gezielte Maßnahmen.
Akustikmaßnahmen in der offenen Zone
Damit die zentrale Teamzone nicht zur Dauerlärmquelle wird, braucht es:
- Deckensegel oder Akustikdecken: Sie absorbieren Schallwellen und reduzieren die Nachhallzeit.
- Mobile Akustiktrennwände: Flexibel einsetzbar, ideal zur temporären Unterteilung.
- Schallabsorbierende Möblierung: Teppichböden, gepolsterte Sitzmöbel oder schallbrechende Regalwände.
Ziel ist es, dass Mitarbeitende sich in dieser Zone austauschen können, ohne einander zu stören – und gleichzeitig nicht in die umliegenden Büros „hinein lärmen“.
Akustische Besonderheiten im Kombibüro
Ein spezielles Risiko entsteht durch die Reflexionen an glatten Flächen – viele Kombibüros nutzen Glaswände, die den Schall besonders gut weiterleiten. Daher sollten Glasflächen ggf. mit schallbrechenden Elementen kombiniert oder als Doppelverglasung mit schalldämmender Funktion ausgeführt sein.
Die Schallschutzstrategie muss ganzheitlich sein
Ein modernes Kombibüro benötigt eine durchdachte akustische Planung, die beide Bereiche einbezieht:
- Bürozellen: Ruhe-Inseln mit gezieltem Schutz vor Störgeräuschen
- Teamzonen: dialogfreundliche, aber akustisch gedämpfte Flächen
Fazit: Akustik ist kein Nebenthema – sie entscheidet darüber, ob das Kombibüro wirklich das verspricht, was es soll: konzentriertes Arbeiten UND offene Kommunikation. Wer hier spart, riskiert Stress, Unzufriedenheit und Fehlplanungen.
Ergonomie und Bildschirmarbeitsplätze im Kombibüro
Ein Kombibüro bringt durch seine Struktur ganz eigene ergonomische Herausforderungen mit sich – schließlich wechseln Mitarbeitende oft zwischen festem Arbeitsplatz in einem Einzelbüro und temporärem Arbeitsplatz in der offenen Zone. Das macht eine durchdachte ergonomische Planung umso wichtiger.
Ergonomie im Einzel- bzw. Kleinstbüro
Diese sogenannten Zellenarbeitsplätze sind meist der persönliche Arbeitsplatz der Mitarbeiter*innen. Hier gelten alle Anforderungen nach ArbStättV Anhang 6 und der neuen ASR A6 „Bildschirmarbeit“:
- Mindesttiefe und Bewegungsfläche: Vor dem Bildschirm muss mindestens 1 Meter Tiefe vorhanden sein, um eine gesunde Sehdistanz zu ermöglichen. Zusätzlich braucht es mindestens 1,5 m² freie Bewegungsfläche.
- Stuhl, Tisch, Bildschirm: Jeder Arbeitsplatz muss mit einem ergonomischen Drehstuhl, einem höhenverstellbaren Tisch (idealerweise elektrisch) und einem blendfrei positionierten Monitor ausgestattet sein.
- Lichtverhältnisse: Jeder Raum benötigt ausreichend Tageslicht und/oder individuell einstellbare künstliche Beleuchtung – Stichwort: visuelle Ergonomie.
Wichtig: Auch wenn das Büro klein ist – die Mindestgrößen dürfen nicht unterschritten werden, sonst ist es kein zulässiger Arbeitsplatz!
Ergonomie in der offenen Gemeinschaftszone
Die offene Fläche wird häufig für Projektarbeit oder spontane Meetings genutzt – aber auch dort gelten dieselben Regeln, wenn hier gearbeitet wird:
- Alle Plätze mit Bildschirmarbeit müssen die Vorgaben aus ArbStättV Anhang 6 erfüllen.
- Auch bei wechselnden Arbeitsplätzen (Hotdesking) muss gewährleistet sein, dass jeder sich den Arbeitsplatz individuell einstellen kann.
- Ergonomische Grundausstattung ist Pflicht: höhenverstellbare Tische, passende Stühle, ggf. Monitore mit Gelenkarm, externe Tastaturen und Laptopständer.
Herausforderung: Doppelstruktur
Das Kombibüro bringt eine Doppelstruktur der Ergonomieanforderungen:
- Zellenbüros = individuell einstellbare Festplätze
- Open Space = flexibel nutzbare Arbeitsinseln
Beide Zonen müssen gleichwertig ergonomisch ausgestattet sein – sonst entstehen gesundheitliche Nachteile.
Bonuspunkt: Bewegung fördern
Das Kombibüro bietet ideale Voraussetzungen für bewegtes Arbeiten: Mitarbeitende wechseln automatisch zwischen verschiedenen Zonen. Arbeitgeber können das fördern durch:
- Steh-Sitz-Arbeitsplätze
- besonders ergonomische Besprechungsecken
- klar ausgeschilderte Ruhe-/Bewegungsbereiche
Ein Kombibüro ist kein Kompromiss – wenn es ergonomisch durchdacht ist, bietet es mehr als klassische Modelle: individuelle Rückzugsorte plus flexible Teamzonen, die Bewegung und Abwechslung in den Arbeitsalltag bringen. Voraussetzung ist allerdings: Jeder Platz – egal ob fest oder flexibel – muss die Anforderungen für Bildschirmarbeit erfüllen.
Datenschutz und Sichtschutz im Kombibüro
Das Kombibüro vereint offene Kommunikation mit individuellen Rückzugsorten – ein Vorteil auch im Hinblick auf Datenschutz. Doch je nach Arbeitsbereich gelten unterschiedliche Anforderungen.
Datenschutz in den Einzelbüros
Die kleinen Einzel- oder Zweierbüros ermöglichen geschütztes Arbeiten. Das ist ideal für sensible Aufgaben wie Personalgespräche oder das Bearbeiten personenbezogener Daten. Entscheidend:
- Türen sollten geschlossen werden, wenn vertrauliche Inhalte besprochen oder verarbeitet werden.
- Bildschirmpositionierung so wählen, dass keine Einblicke vom Flur aus möglich sind – idealerweise mit Sichtschutzfolie oder Milchglas an Türen.
- Wer personenbezogene Daten verarbeitet, muss den Arbeitsplatz beim Verlassen sichern (PC sperren, Unterlagen wegschließen).
Hier greifen die Regelungen aus DSGVO Art. 32 und der Arbeitsstättenverordnung §3a.
Herausforderungen durch Glaswände
Viele Kombibüros setzen auf transparente Trennwände zur Mittelzone hin. Das bringt Licht, aber auch Sichtprobleme. Sichtschutzstreifen oder halbtransparente Folien sind sinnvoll, wenn:
- Bildschirminhalte von außen sichtbar wären.
- Besucher oder Kolleg*innen könnten im Vorbeigehen sensible Informationen sehen.
Für Räume mit personenbezogenen Daten ist ein „offener“ Glaseinblick nicht DSGVO-konform – hier braucht es gezielte Abschirmung.
Datenschutz in der offenen Zone
In der offenen Mitte des Kombibüros gelten dieselben Vorgaben wie im klassischen Großraumbüro:
- Keine sensiblen Gespräche im offenen Bereich – dafür gibt es Rückzugsräume.
- Clean-Desk-Prinzip konsequent umsetzen: keine persönlichen Unterlagen dauerhaft offen liegen lassen.
- Bildschirmfilter und sichere Geräte (Auto-Lock, verschlüsselte Datenübertragung) einsetzen.
Wenn Mitarbeitende täglich den Platz wechseln, braucht es zudem:
- Schließfächer oder persönliche Ablagemöglichkeiten
- eine klare Clean-Desk-Policy (am besten schriftlich fixiert und unterwiesen)
Organisatorische Maßnahmen
Arbeitgeber sind verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten. Im Kombibüro bedeutet das konkret:
- Unterweisungen zum Datenschutz bei wechselnden Arbeitsplätzen.
- Klare Zonierungen: Wo darf mit sensiblen Daten gearbeitet werden, wo nicht?
- ggf. Zugangsbeschränkungen für bestimmte Bereiche (z. B. Personalbüros, HR).
Auch wenn das Kombibüro modern gestaltet ist – es darf nicht zum Risiko für Datenschutz werden. Deshalb müssen gestalterische Offenheit und verbindliche Regeln Hand in Hand gehen.
Allgemeiner Arbeitsschutz im Kombibüro
Das Kombibüro bringt zwei Welten zusammen: offene Kommunikation und konzentrierte Einzelarbeit. Genau das macht den Arbeitsschutz hier so besonders – denn beide Bereiche stellen unterschiedliche Anforderungen.
Doppelter Fokus: Zellen und offene Flächen
In einem Kombibüro müssen Arbeitgeber zwei Arbeitsumgebungen gleichzeitig bewerten:
- Einzelbüros (Zellen): Ruhige Rückzugsorte, meist kleiner Raum – geringe physikalische Belastungen, aber potenzielle Risiken durch zu enge Raumverhältnisse oder schlechte Belüftung.
- Offene Zonen: Kommunikationsbereiche, Begegnungsflächen – hier dominieren psychische Belastungen (z. B. Lärm, ständige Unterbrechung, kein fester Platz).
Die Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG muss deshalb beide Raumtypen und ihre Interaktion berücksichtigen – inklusive Wechselwirkung: Wer oft zwischen Rückzug und Kommunikation hin- und herpendelt, benötigt klare Strukturen und Routinen.
Vorteile richtig nutzen
Das Kombibüro bietet viele Chancen aus Sicht des Arbeitsschutzes:
- Stressreduktion durch individuell nutzbare Rückzugsräume
- Förderung gesunder Arbeitsweisen durch Abwechslung zwischen Teamarbeit und stiller Konzentration
- Bessere Selbststeuerung durch freie Platzwahl
Damit diese Vorteile wirken, braucht es gezielte Maßnahmen:
- Nutzer-Schulungen, wie man Arbeitsumgebungen sinnvoll nutzt (z. B. wann Türen schließen, wann ins Team-Bereich wechseln)
- Vermeidung von Reizüberflutung: Die offene Zone sollte akustisch, visuell und klimatisch nicht überfordern
- Regelmäßige Rückmeldeschleifen: Feedbackrunden zum Raumempfinden und zur Arbeitsqualität helfen, frühzeitig auf Probleme zu reagieren
Gesundheitsschutz in der Praxis
Typische Risiken im Kombibüro, die Arbeitgeber im Blick haben müssen:
- Kognitive Überlastung: durch häufige Wechsel des Arbeitsplatzes, viele Reize in der offenen Zone
- Fehlende Rückzugsmöglichkeiten, wenn Bürozellen zu klein oder durch andere belegt sind
- Lichtstress, wenn große Helligkeitsunterschiede zwischen Einzelraum und Mittelzone bestehen
- Luftqualität, insbesondere in sehr kleinen Einzelbüros mit unzureichender Lüftung
Deshalb empfiehlt sich:
- klare Regelung zur Raumnutzung (Wer darf wann wohin?)
- Transparente Nutzungshinweise in Form von Piktogrammen, Beschilderung oder digitalen Tools (z. B. Raumbuchungssysteme)
- optische und akustische Alarmierung bei Notfällen – Einzelbüros sind ggf. vom allgemeinen Alarm schlechter zu erreichen
Sicherheitsbeauftragte und Unterweisung
Auch in modernen Kombibüros gelten alle bekannten Pflichten:
- Mindestens ein Ersthelfer und ein Brandschutzhelfer pro 20 Beschäftigte
- Jährliche Unterweisung zu Arbeitsschutz, Fluchtwegen, Brandschutz, ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung
- Aushänge zu Fluchtwegen, Sammelpunkten, internen Notfallnummern – überall sichtbar, auch in Einzelräumen
Das Kombibüro darf nicht dazu führen, dass Sicherheitsverantwortung auf die Beschäftigten abgeschoben wird. Im Gegenteil: Es braucht ein solides Sicherheitskonzept, das mit der Flexibilität Schritt hält.
Brandschutz im Kombibüro
Das Kombibüro kombiniert abgeschlossene Zellen mit offenen Flächen – das stellt besondere Anforderungen an den baulichen und organisatorischen Brandschutz. Gerade weil beide Raumtypen ineinandergreifen, muss der Schutz ganzheitlich gedacht werden.
Flächenstruktur und Brandabschnitt
In vielen Fällen bildet das gesamte Kombibüro – also Einzelräume plus offene Mittelzone – einen gemeinsamen Brandabschnitt, insbesondere wenn die Trennwände zwischen den Zellen nicht deckenhoch ausgeführt sind oder gläsern gestaltet wurden.
Wichtig ist dabei:
- Fläche > 400 m² → in der Regel zwei Fluchtwege notwendig (ASR A2.3)
- Fluchtweglänge max. 35 Meter bis zum nächsten Ausgang – auch innerhalb der Mittelzone muss dieser Abstand eingehalten werden
- Rettungswegführung durch offene Zonen: Werden offene Mittelbereiche als Verkehrsflächen genutzt, müssen sie jederzeit frei zugänglich und klar markiert sein
Türsysteme und Evakuierung
Ein markanter Punkt: Im Brandfall müssen alle Personen aus ihren Einzelräumen in die offene Zone gelangen. Deshalb ist auf Folgendes zu achten:
- Türen der Bürozellen nach außen öffnend und nicht verschließbar (bzw. von innen jederzeit zu öffnen)
- Ggf. Einsatz von Paniktürbeschlägen, falls die Personenzahl oder baurechtliche Vorgaben es verlangen
- Optische und akustische Alarme in allen Teilbereichen – gerade Einzelräume können durch normale Sirenen in der Mitte überhört werden
Technische Einrichtungen
Die Technik im Kombibüro sollte den Brandverlauf verlangsamen und schnelle Reaktion ermöglichen:
- Rauchmelder in allen Teilbereichen, auch in Einzelbüros
- Sprinkleranlagen bei großen Gesamtflächen (zunehmend Standard in Neubauten)
- Feuerlöscher alle 200 m² – idealerweise wandmontiert und deutlich gekennzeichnet, da flexible Möblierung sonst das Auffinden erschwert
- Rauchschutzverglasung oder Brandschutztüren zwischen Zellen und offener Zone bei Bedarf
Organisation und Schulung
Auch im Kombibüro gilt: Ohne ein durchdachtes Alarm- und Räumungskonzept wird es im Ernstfall unübersichtlich. Deshalb:
- Evakuierungshelfer benennen: Mind. 1 pro 20–30 Personen
- Evakuierungsübungen regelmäßig durchführen – besonders, um das Verhalten beim Verlassen der Einzelräume zu trainieren
- Brandschutzordnung Teil B gut sichtbar aushängen, auch in Randbereichen
- Achtung bei verglasten Zellen: Sichtverbindung zu Fluchtwegen gewährleisten, damit Menschen bei Rauchentwicklung Orientierung behalten
Kombibüros als moderner Kompromiss im Büroalltag
Das Kombibüro steht sinnbildlich für den Versuch, die besten Elemente traditioneller und moderner Büroformen zu vereinen. Einzelne, ruhige Arbeitszellen bieten Rückzug und Konzentration, während offene Kommunikationszonen den Austausch im Team ermöglichen. Damit reagiert dieses Konzept gezielt auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt – insbesondere auf den Wunsch nach Flexibilität, individueller Arbeitsweise und gesundem Arbeitsumfeld.
Unternehmen, die ein Kombibüro planen oder optimieren, sollten neben gestalterischen Aspekten vor allem auch rechtliche Anforderungen, Raumakustik und Datenschutz im Blick behalten. Der Schlüssel liegt in der Balance: Nur wenn alle Bereiche – offen wie geschlossen – durchdacht gestaltet und arbeitsrechtlich einwandfrei umgesetzt sind, entfaltet das Kombibüro sein ganzes Potenzial.
Ob als Neuplanung oder Umbau: Das Kombibüro ist ein wandelbares Konzept mit vielen Facetten – und deshalb gerade für hybride Teams, projektorientierte Strukturen und wissensbasierte Tätigkeiten eine spannende Option.
Kombibüro – häufige Fragen kompakt beantwortet
Was ist ein Kombibüro?
Ein Kombibüro ist ein Bürokonzept, das kleine Einzelbüros („Zellen“) mit offenen Gemeinschaftszonen kombiniert. So können Rückzug und Teamarbeit flexibel genutzt werden.
Welche Vorteile bietet ein Kombibüro?
Kombibüros fördern konzentriertes Arbeiten und gleichzeitig spontanen Austausch. Sie bieten mehr Privatsphäre als Großraumbüros und sind dennoch kommunikativ.
Wie groß ist ein Kombibüro typischerweise?
Die Einzelbüros müssen laut ArbStättV mindestens 8 m² pro Person bieten. Für offene Bereiche wird meist mit 12–15 m² pro Arbeitsplatz geplant. Insgesamt ist der Flächenbedarf höher als bei klassischen Konzepten.
Welche Anforderungen gelten für die Ausstattung?
Sowohl die Einzelzellen als auch die offenen Zonen müssen ergonomisch, gut beleuchtet und ausreichend belüftet sein. Auch Lärmschutz und Datenschutz müssen erfüllt sein.
Ist ein Kombibüro für jedes Unternehmen geeignet?
Besonders gut passt das Modell für projektbasierte Teams, wissensintensive Arbeit und hybride Arbeitskonzepte. Wichtig ist eine klare Raumaufteilung und gute Planung.
Wo finde ich die Gesetzestexte zum Open Office?
Zu den rechtlichen Details:
• Büroflächen richtig berechnen (ASR A1.2)
• Schallschutz & Akustik im Büro (ASR A3.7, DIN 4109)
• Datenschutz im Büroalltag (DSGVO & Sichtschutz)
• Arbeitsschutz im Büro (ArbStättV & ArbSchG)