Wenn „hell genug“ nicht mehr reicht
Ein Büro mit Licht ist noch lange kein Büro mit guter Beleuchtung. Denn was oft als „ausreichend hell“ durchgeht, kann in Wahrheit unproduktiv, ungesund – oder schlicht ungemütlich sein.
Gutes Licht am Arbeitsplatz bedeutet mehr als Ein/Aus. Es sorgt für Konzentration, verhindert Ermüdung, steigert die Stimmung – und spart im besten Fall sogar Energie.
In diesem Beitrag erfährst du:
- Welche Beleuchtungskonzepte es im Büro gibt – und welches zu deinem Arbeitsstil passt
- Warum die Mischung aus direktem und indirektem Licht oft die beste Lösung ist
- Wie intelligente Lichtsteuerung den Alltag effizienter und angenehmer macht
Drei Beleuchtungskonzepte im Büro – was passt zu wem?
Nicht jeder Arbeitsplatz benötigt dieselbe Art von Licht. Die DGUV unterscheidet drei grundlegende Beleuchtungskonzepte – je nachdem, wie flexibel der Raum ist, was dort gearbeitet wird und wer dort arbeitet.
🏢 1. Raumbezogene Beleuchtung
Hier wird der gesamte Raum gleichmäßig ausgeleuchtet – unabhängig davon, wo genau sich der Arbeitsplatz befindet. Dieses Konzept eignet sich besonders für:
- Open-Space-Büros, in denen die Schreibtische regelmäßig umgestellt werden
- Besprechungsräume oder Mehrzweckbereiche
- Arbeitsplätze mit hoher Flexibilität und Beweglichkeit
Vorteil: Einfache Planung, keine punktuelle Ausleuchtung nötig
Nachteil: Nicht auf einzelne Tätigkeiten abgestimmt – kann zu Über- oder Unterbeleuchtung führen
👩💻 2. Arbeitsplatzbezogene Beleuchtung
Hier steht der konkrete Arbeitsplatz im Fokus: Die Beleuchtung ist genau dort, wo gearbeitet wird – angepasst an die jeweilige Tätigkeit. Ideal für:
- Feste Arbeitsplätze mit klarer Aufgabenverteilung
- Einzelbüros oder Teamzonen mit wenig Veränderung
- Bildschirmarbeitsplätze mit ergonomischer Ausstattung
Vorteil: Zielgerichtetes Licht, weniger Energieverbrauch, bessere Ergonomie
Nachteil: Weniger flexibel bei Umstrukturierungen
✍️ 3. Teilflächenbezogene Beleuchtung
Dieses Konzept ergänzt die Grundbeleuchtung durch zusätzliche Lichtquellen – z. B. Schreibtischlampen oder Stehleuchten, dort wo besonders viel Licht gebraucht wird. Typisch für:
- Präzisionsarbeiten, z. B. Zeichnen, Prüfen, Lesen
- Ältere Mitarbeitende mit höherem Lichtbedarf
- Kombination mit Arbeitsplatzbeleuchtung für mehr Individualität
Vorteil: Höchste Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse
Nachteil: Bedarf an Abstimmung mit Grundbeleuchtung
🛠️ Alltagsszenarien zur Verdeutlichung:
- Im Großraumbüro, wo ständig neue Teamkonstellationen entstehen, ist raumbezogenes Licht ideal.
- Im Einzelbüro, in dem täglich Bildschirmarbeit stattfindet, hilft arbeitsplatzbezogenes Licht gezielt weiter.
- In kreativen oder sensiblen Bereichen kommt teilflächenbezogenes Licht zum Einsatz – flexibel und punktgenau.
Direkt, indirekt oder gemischt? Lichtarten im Überblick
Gute Bürobeleuchtung besteht nicht nur aus der „einer richtigen Lampe“. Entscheidend ist, wie das Licht den Raum trifft – und wie es sich verteilt. Die DGUV unterscheidet dabei zwischen drei Lichtarten, die je nach Einsatzort Vor- und Nachteile haben.

🔦 Direktbeleuchtung
Hier strahlt das Licht gezielt nach unten auf den Arbeitsplatz. Typisch sind Spots, Downlights oder klassische Deckenleuchten.
Vorteile:
- Hohe Lichtausbeute auf der Arbeitsfläche
- Ideal für fokussiertes Arbeiten
Nachteile:
- Kann zur Blendung führen
- Harte Schattenbildung möglich
- Wirkt oft „kalt“ oder technisch
💡 Indirektbeleuchtung
Das Licht wird nicht direkt abgestrahlt, sondern über Wände oder Decken reflektiert – z. B. durch Up-Lights oder diffuse Leuchtpaneele.
Vorteile:
- Sehr weiches, blendfreies Licht
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Angenehmes Raumgefühl
Nachteile:
- Weniger Lichtausbeute auf der Arbeitsfläche
- Kann bei alleiniger Nutzung zu wenig Kontrast bieten
🔁 Mischbeleuchtung
Die Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung – und laut DGUV meist die beste Lösung. Sie bietet Struktur, Ausgewogenheit und lässt sich flexibel anpassen.
Vorteile:
- Beste Balance aus Funktionalität und Komfort
- Ermöglicht differenzierte Lichtzonen
- Unterstützt produktives und angenehmes Arbeiten
DGUV-Tipp: Vermeide harte Hell-Dunkel-Kontraste und setze auf weiche Übergänge – so wirkt Licht ergonomisch und entlastet die Augen.
Vergleich auf einen Blick:
| Lichtart | Wirkung | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Direkt | gezielt, fokussiert | Schreibtisch, Besprechungstisch |
| Indirekt | weich, blendarm | Allgemeinbeleuchtung, Deckenflächen |
| Mischform | ausgewogen, flexibel | Ideallösung für moderne Büros |
Lichtmanagement im Büro – Automatisch besser beleuchtet
Licht an, Licht aus – das war gestern. In modernen Büros übernimmt heute oft ein intelligentes Lichtmanagement-System die Steuerung. Und das hat viele Vorteile: mehr Effizienz, bessere Lichtqualität – und weniger Stress im Alltag.

Was ist Lichtmanagement?
Ein solches System regelt Helligkeit, Lichtfarbe und Laufzeit automatisch – je nach Tageszeit, Nutzung oder Anwesenheit im Raum. Es denkt mit, passt sich an und hilft dabei, die Beleuchtung dynamisch zu optimieren.
Vorteile für den Büroalltag:
- Tageslichtintegration: Wenn genug Sonnenlicht ins Büro fällt, dimmt sich das künstliche Licht automatisch herunter – das spart Strom und wirkt natürlicher.
- Präsenzsteuerung: Räume, die nicht genutzt werden, bleiben dunkel. Sobald jemand den Raum betritt, geht das Licht sanft an.
- Szenensteuerung: Besprechung, Kreativarbeit oder Fokusphase? Lichtsysteme lassen sich auf Knopfdruck an die jeweilige Tätigkeit anpassen.
- Wartungserleichterung: Moderne Systeme melden Ausfälle oder Wartungsbedarf automatisch – weniger Ausfallzeiten, besserer Überblick.
🛠️ Beispiele aus der Praxis:
- Im Besprechungsraum passt sich das Licht an Präsentationen an – gedimmt fürs Beamerbild, hell fürs Whiteboard.
- Im Homeoffice lässt sich das Licht morgens sanft hochdimmen und abends automatisch zurückfahren – ganz ohne Knopfdruck.
- In Teambüros sorgt die Kombination aus Tageslichtsensor und Anwesenheitserkennung für maximale Energieeffizienz.
Tipps für die Praxis: So gelingt die Beleuchtungsplanung
Ob Neubau, Umbau oder Optimierung – eine gute Beleuchtungsplanung beginnt mit den richtigen Fragen. Die DGUV gibt dafür klare Empfehlungen, die sich auch ohne Fachkenntnisse gut anwenden lassen.
Hier kommt die kompakte Planungs-Checkliste:
📋 Planungs-Checkliste für gesunde Bürobeleuchtung
✅ Wo wird gearbeitet?
– Einzelarbeitsplatz, Großraumbüro, Homeoffice oder Besprechungszone?
→ Unterschiedliche Raumtypen erfordern unterschiedliche Konzepte.
✅ Welche Aufgaben werden dort erledigt?
– Bildschirmarbeit, Lesen, Besprechen, Konzentrieren, Kreativarbeit?
→ Je nach Tätigkeit sind andere Lichtarten und Helligkeiten sinnvoll.
✅ Wer arbeitet dort?
– Jüngere, ältere, mobile Teams oder fest zugewiesene Mitarbeitende?
→ Alter und Sehvermögen beeinflussen den Lichtbedarf stark.
✅ Welche Lichtquellen sind bereits vorhanden?
– Gibt es ausreichend Tageslicht? Ist die künstliche Beleuchtung flexibel nutzbar?
→ Nutze vorhandene Ressourcen effizient – z. B. mit Tageslichtsensoren.
✅ Wie flexibel soll die Einrichtung bleiben?
– Wird oft umgebaut oder umgestellt?
→ Raumbezogene Lösungen oder Lichtmanagement-Systeme schaffen hier Vorteile.
🛠️ Praxis-Tipp: Bei der Auswahl neuer Leuchten nicht nur auf Design oder Helligkeit achten – sondern auf:
- Blendfreiheit
- Flimmerfreiheit
- passende Lichtfarbe
- Farbwiedergabeindex (Ra ≥ 80)
Fazit: Gutes Licht kommt nicht von ungefähr
Licht ist einer der meistunterschätzten Faktoren für Produktivität und Wohlbefinden im Büro. Doch wer systematisch plant statt nur „hell genug“ denkt, kann enorme Vorteile schaffen – für Mitarbeitende, Unternehmen und Umwelt.
Ob durchdachtes Lichtkonzept, ausgewogene Lichtarten oder cleveres Lichtmanagement: Gute Beleuchtung steigert die Konzentration, reduziert Belastungen und sorgt für echte Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz.
🔎 Starke Planung bringt:
- Weniger Ermüdung, mehr Energie
- Bessere Ergonomie und visuelle Klarheit
- Flexiblere Nutzung von Räumen und Ressourcen
- Spürbare Energieeinsparungen
📚 Tipp: Wer die Serie komplett lesen möchte:
- In Teil 1 ging es um Tageslicht und Tageslichtlampen im Büro
- In Teil 2 erfährst du alles über Blendung, Lichtqualität und Farbwiedergabe
👉 Und jetzt weißt du auch, wie du Licht gezielt planst und steuerst – für mehr Komfort, Gesundheit und Effizienz.
📊 Vergleich: klassisches Licht vs. modernes Lichtkonzept
| Kriterium | Klassische Bürobeleuchtung | Modernes Lichtkonzept |
|---|---|---|
| Lichtverteilung | Einheitlich, oft unflexibel | Zoniert & bedarfsgerecht |
| Lichtarten | Meist rein direkt | Mischung aus direkt & indirekt |
| Anpassbarkeit | Manuell, oft starr | Automatisch, nutzungsabhängig |
| Energieeffizienz | Teilweise veraltet | Optimiert durch Sensorik & Steuerung |
| Ergonomie | Wenig berücksichtigt | Integriert in Arbeitsplatzgestaltung |
| Wohlfühlfaktor | Funktional, aber kühl | Angenehm, stimmungsfördernd |
📋 Checkliste: So gelingt die Lichtplanung im Büro
✅ Arbeitsplatztypen analysieren: Einzelbüro, Open Space, Besprechung, Homeoffice
✅ Tageslicht berücksichtigen: Fensterflächen, Raumtiefe, Ausrichtung
✅ Passende Lichtarten kombinieren: Direkt + Indirekt = optimale Balance
✅ Lichtfarbe gezielt wählen: Neutralweiß oder Tageslichtweiß für Fokus
✅ Farbwiedergabe prüfen: Ra-Wert ≥ 80 für natürliche Farbwahrnehmung
✅ Flimmer- und blendfreie Leuchten bevorzugen
✅ Lichtmanagement-Systeme prüfen: Anwesenheit, Tageslichtsteuerung, Szenen
✅ Zukunft mitdenken: Modular planen für Umbauten & neue Arbeitsplatzmodelle
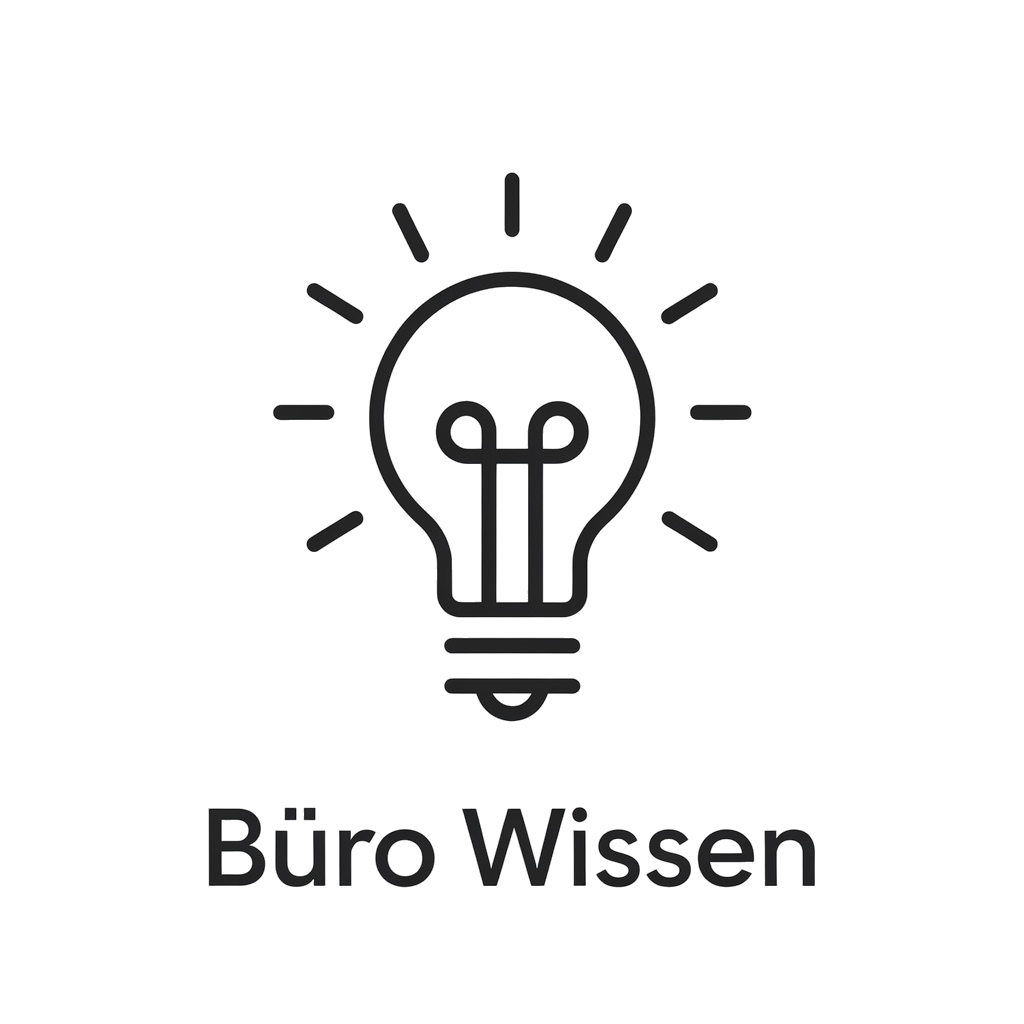

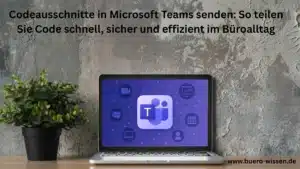
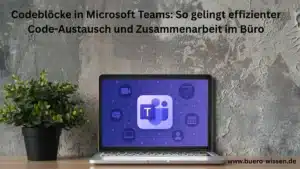
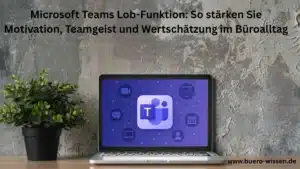
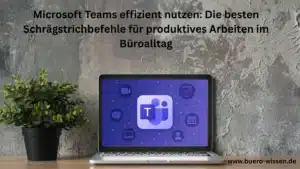
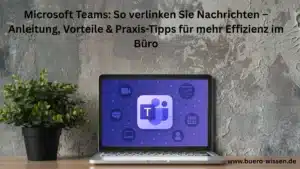
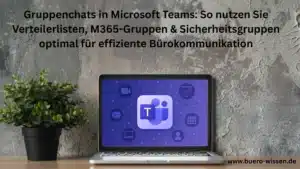
5 Antworten
Der Artikel bietet interessante Einblicke in die verschiedenen Beleuchtungskonzepte für Büros. Besonders die Unterscheidung zwischen raumbezogener und arbeitsplatzbezogener Beleuchtung ist hilfreich, um gezielt die richtige Lichtgestaltung auszuwählen.
Ich finde die Diskussion über Lichtmanagement-Systeme sehr relevant. Automatische Anpassungen an die Tageszeit können sicherlich dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig ein angenehmeres Arbeitsumfeld zu schaffen.
Die Vorteile der Mischbeleuchtung werden hier gut erklärt. Eine ausgewogene Kombination aus direktem und indirektem Licht scheint tatsächlich eine sinnvolle Lösung zu sein, um sowohl Funktionalität als auch Komfort im Büro zu gewährleisten.
Die Checkliste zur Planung gesunder Bürobeleuchtung ist eine praktische Hilfe. Sie bietet klare Anhaltspunkte, wie man unterschiedliche Arbeitsplatztypen und Tätigkeiten in der Lichtgestaltung berücksichtigen kann.
Ich stimme zu, dass gutes Licht einen wesentlichen Einfluss auf Produktivität und Wohlbefinden hat. Die Tipps zur Auswahl von Leuchten sind nützlich, um bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes auf wichtige Aspekte wie Blendfreiheit und Farbwiedergabe zu achten.