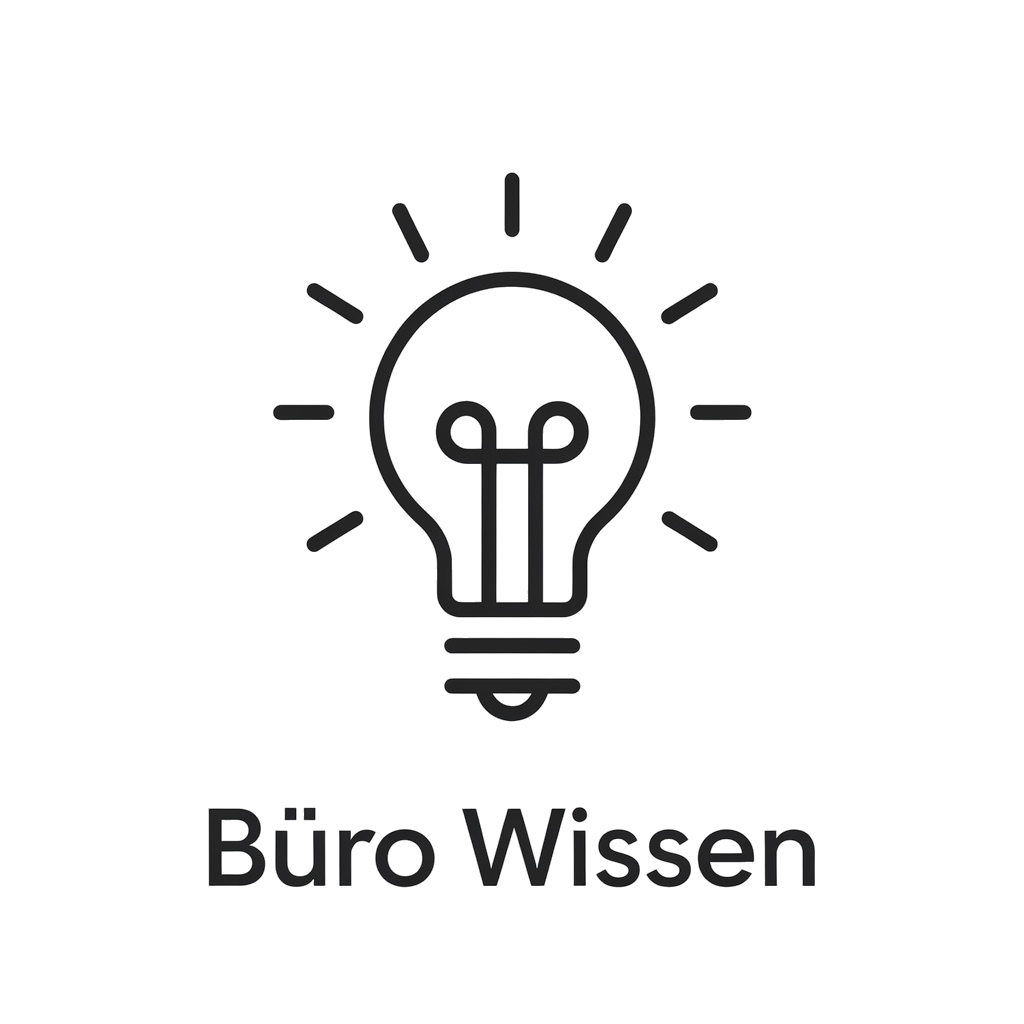Büroformen einfach erklärt: Vom klassischen Einzelbüro bis hin zur modernen Open-Space-Landschaft – Unternehmen stehen heute vor der Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Arbeitswelten. Häufig gesucht wird: „Welche 4 Büroformen gibt es?“ – in der Realität aber sind es in modernen Unternehmen 6 Büroformen, die relevant und weitverbreitet sind.
Dieser Artikel gibt dir einen klar strukturierten Überblick, nennt typische Vor- und Nachteile und hilft dir dabei, die passende Lösung für dein Team, deine Aufgaben und deine Unternehmensstruktur zu finden.
Kurze Übersicht: Die 6 wichtigsten Büroformen in Unternehmen
| Büroform | Typisch für … | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Einzelbüro | Klassisch, vertraulich, ruhig | Abgeschlossener Raum für eine Person – viel Ruhe, aber wenig Teamdynamik. |
| Zellenbüro | Kleine Teams mit Fokusarbeit | 2–4 Personen pro Raum – ruhig, aber mit eingeschränkter abteilungsübergreifender Kommunikation. |
| Gruppenbüro | Projektteams, Abteilungen | 7–15 Personen in einem Raum – gute Abstimmung im Team, aber teils lauter. |
| Großraumbüro | Große Unternehmen, zentrale Teams | Ganze Etage mit offenen Arbeitsplätzen – viel Flexibilität, aber hoher Geräuschpegel. |
| Kombibüro | Unternehmen mit Fokus auf Flexibilität | Mischung aus Einzelarbeitsplatz + Gemeinschaftsbereich – Rückzug & Zusammenarbeit in Balance. |
| Open Space | Moderne, dynamische Organisationen | Bürolandschaft mit Zonen (Fokus, Kreativbereich, Lounge) – offen, flexibel, aber akustisch fordernd. |
Im Porträt: Die 6 Büroformen – Stärken, Schwächen & Einsatzbereiche
Du kennst jetzt die grundlegenden Unterschiede zwischen den gängigen Büroformen. Doch worauf kommt es im Detail an? Welche Arbeitsweisen lassen sich in welchem Raumkonzept optimal umsetzen – und wo lauern mögliche Herausforderungen?
In den folgenden Kurzporträts erfährst du, was jede Büroform konkret auszeichnet: typische Vor- und Nachteile, praxisnahe Einsatzszenarien sowie erste Empfehlungen für die Auswahl. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, findest du zu jedem Modell einen verlinkten Detailartikel – dort gehen wir auch auf Themen wie rechtliche Anforderungen, ArbStättV, Datenschutz, DIN-Normen oder Gestaltungstipps ein.
Einzelbüro: Der Klassiker für ungestörte Konzentration
Das Einzelbüro zählt zu den traditionellen Büroformen und steht sinnbildlich für Ruhe, Fokus und Diskretion. Eine Person, ein Raum – ideal für Aufgaben, die hohe Konzentration und sensible Datenverarbeitung erfordern.

Typische Vorteile:
- Maximale Privatsphäre: Störungen von außen sind minimal, vertrauliche Gespräche möglich.
- Individuelle Kontrolle: Licht, Klima, Ausstattung – alles kann angepasst werden.
- Hohes Ruhepotenzial: Optimal für analytische oder kreative Tätigkeiten.
Typische Nachteile:
- Hoher Flächenbedarf: Einzelräume sind teuer im Bau und Betrieb.
- Weniger Teamdynamik: Spontaner Austausch erfordert aktive Kommunikation.
- Isolation möglich: Soziale Interaktion findet nur außerhalb des Büros statt.
🔗 Mehr dazu im Detailartikel: Einzelbüro im Fokus: Vor- und Nachteile, Regeln & Tipps
Zellenbüro: Kleine Teams, klare Strukturen
Das Zellenbüro ist eine Weiterentwicklung des Einzelbüros – hier teilen sich meist zwei bis vier Personen einen abgeschlossenen Raum. Als klassische Büroform mit Struktur bietet es eine gute Balance zwischen Konzentration und Teamarbeit, vorwiegend für Fachabteilungen oder projektbezogene Duos.

Typische Vorteile:
- Ruhige Arbeitsatmosphäre: Konzentration bleibt möglich, auch im kleinen Team.
- Vertrauliches Arbeiten: Ideal für sensible Daten oder datenschutzkritische Aufgaben.
- Kurze Kommunikationswege: Teammitglieder im selben Raum tauschen sich unkompliziert aus.
Typische Nachteile:
- Wenig Flexibilität: Wände machen spontane Umstrukturierungen aufwendig.
- Eingeschränkter Austausch nach außen: Zusammenarbeit mit anderen Teams muss aktiv gesucht werden.
- Flächenaufwand bleibt hoch: Verkehrsflächen (Flure etc.) benötigen ebenfalls Raum.
🔗 Mehr dazu im Detailartikel: Zellenbüro: So funktionieren kleine Teamräume
Gruppenbüro: Teamarbeit mit kurzen Wegen
Das Gruppenbüro gehört zu den modernen Büroformen, die Zusammenarbeit fördern – ohne komplett auf Privatsphäre zu verzichten. In einem Raum arbeiten größtenteils 7 bis 15 Personen derselben Abteilung oder eines Projektteams. Die offene Struktur ermöglicht schnellen Austausch, fordert aber auch Rücksichtnahme.

Typische Vorteile:
- Direkte Kommunikation: Spontane Absprachen und kurze Abstimmungswege stärken die Teamdynamik.
- Gemeinsame Nutzung: Technik, Drucker oder Lagerflächen lassen sich effizient teilen.
- Flexibler als Einzelräume: Die Möblierung kann einfacher umgestellt werden als bei festen Wänden.
Typische Nachteile:
- Störungen durch Gespräche: Hintergrundgeräusche können die Konzentration erschweren.
- Weniger individuelle Kontrolle: Licht, Klima und Geräuschpegel sind meist nicht personalisierbar.
- Begrenzte Privatsphäre: Vertrauliche Gespräche oder sensible Daten erfordern Rückzugsräume.
🔗 Mehr dazu im Detailartikel: Gruppenbüros optimal nutzen: Vorteile, Grenzen & Tipps
Großraumbüro: Effizienz trifft Kommunikation – mit Nebenwirkungen
Das Großraumbüro ist wohl die bekannteste Form der offenen Bürostruktur. Auf großen Flächen (ab ca. 400 m²) arbeiten oft ganze Abteilungen oder Unternehmensbereiche gemeinsam – mit viel Sichtkontakt, aber auch vielen akustischen Herausforderungen.

Typische Vorteile:
- Maximale Flexibilität: Arbeitsplätze lassen sich einfach umorganisieren, Teams schnell neu zusammensetzen.
- Kommunikationsstark: Kurze Wege fördern Austausch und Zusammenarbeit – vorwiegend in dynamischen Organisationen.
- Flächeneffizienz: Geringerer Bauaufwand im Vergleich zu Einzel- oder Zellenbüros.
Typische Nachteile:
- Hoher Geräuschpegel: Telefonate, Gespräche und Drucker sorgen für ständige Hintergrundgeräusche.
- Wenig Rückzugsmöglichkeiten: Wer Ruhe benötigt, muss sich aktiv in separate Zonen zurückziehen.
- Standardisierung statt Individualisierung: Temperatur, Licht und Ausstattung gelten vornehmlich „für alle“.
🔗 Mehr dazu im Detailartikel: Großraumbüro – Anforderungen, Vorteile & Herausforderungen auf einen Blick
Kombibüro: Rückzug und Austausch in perfekter Balance
Das Kombibüro gilt als eine der neuen Büroformen, die klassische Elemente mit modernen Ansprüchen verbinden. Mitarbeitende haben hier kleine Einzelarbeitsplätze (oft entlang der Fenster) und zusätzlich eine zentrale Gemeinschaftszone, die für Austausch, Meetings oder kreative Arbeit genutzt wird.

Typische Vorteile:
- Flexibler Wechsel: Je nach Aufgabe kann zwischen Fokusarbeit und Teamkommunikation gewechselt werden.
- Rückzugsorte inklusive: Persönliche Konzentrationszonen bleiben erhalten – ideal bei anspruchsvollen Aufgaben.
- Förderung informeller Kommunikation: Die zentrale Zone regt spontanen Austausch an.
Typische Nachteile:
- Doppelstruktur braucht mehr Raum: Sowohl Einzel- als auch Gemeinschaftsflächen benötigen Platz.
- Höherer Planungsaufwand: Akustik, Lichtführung und Möblierung müssen gut abgestimmt sein.
- Ausstattungsintensiv: Zwei Nutzungsarten bedeuten meist auch zwei Infrastruktursets.
🔗 Mehr dazu im Detailartikel: Kombibüro: Rückzug und Teamarbeit clever kombiniert
Open Space Office: Viel Raum für Kreativität – mit Struktur
Das Open Space Office ist die modernste Büroform und kombiniert Großzügigkeit mit Vielfalt. Statt fester Arbeitsplätze gibt es Zonen für unterschiedliche Tätigkeiten: von ruhigen Fokusbereichen über Meeting-Cubes bis zu Lounge-Zonen. Häufig wird nach dem Prinzip Activity-Based Working gearbeitet – jeder sucht sich den Platz, der gerade passt.

Typische Vorteile:
- Zoniertes Arbeiten: Je nach Aufgabe wechseln Mitarbeitende zwischen Ruhe-, Kommunikations- und Kreativzonen.
- Hohe Flächeneffizienz bei Desk-Sharing: Nicht jeder benötigt ständig einen festen Platz – das spart Raum.
- Innovationsfördernd: Offene Atmosphäre erleichtert Vernetzung und Ideenentwicklung.
Typische Nachteile:
- Akustische Herausforderungen: Trotz Zonierung bleibt es in vielen Bereichen laut und unruhig.
- Weniger Kontrolle: Klima, Licht und Geräusche lassen sich oft nicht individuell regulieren.
- Selbstdisziplin nötig: Ohne klare Regeln (z. B. Clean-Desk-Policy) wird’s schnell chaotisch.
🔗 Mehr dazu im Detailartikel: Open Space Office: Moderne Büroform mit maximaler Flexibilität.
Rechtliche & organisatorische Anforderungen: Das solltest du beachten
Egal welche Büroform du wählst – rechtliche Mindeststandards gelten immer. Sie betreffen unter anderem Flächenbedarf, Lärmschutz, Beleuchtung, Raumklima, Brandschutz und natürlich den Datenschutz. Diese Anforderungen ergeben sich vorwiegend aus:
- der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
- den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR),
- dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
- sowie den Datenschutzvorgaben der DSGVO.
Wichtig zu wissen: Je offener das Konzept, desto komplexer die Anforderungen. In Großraumbüros oder Open-Space-Strukturen sind z. B. Schallschutz und Datenschutz besonders sensibel – während in Zellen- oder Einzelbüros primär Belüftung und Luftraum pro Person zählen.
Wenn du also planst, dein Büro umzugestalten oder neu zu bauen, lohnt sich ein Blick in die konkreten Vorschriften. In unseren vertiefenden Artikeln findest du dafür alles im Detail – praxisnah erklärt, mit Checklisten und Planungsbeispielen.
🔗 Zu den rechtlichen Details:
• Büroflächen richtig berechnen (ASR A1.2)
• Schallschutz & Akustik im Büro (ASR A3.7, DIN 4109)
• Datenschutz im Büroalltag (DSGVO & Sichtschutz)
• Arbeitsschutz im Büro (ArbStättV & ArbSchG)
Fazit & Entscheidungshilfe: Welche Büroform passt zu dir?
Es gibt nicht die eine perfekte Büroform – sondern nur die passende für deinen Bedarf. Faktoren wie Teamgröße, Arbeitsweise, Kommunikationsstil, Budget und Datenschutzanforderungen spielen eine zentrale Rolle bei der Wahl des passenden Konzepts.

Hier eine erste Orientierungshilfe:
| Wenn … | Dann passt eher … |
|---|---|
| du konzentrierte Einzelarbeit brauchst | 🔒 Einzelbüro oder Zellenbüro |
| dein Team viel kommuniziert | 🤝 Gruppen- oder Großraumbüro |
| du Rückzug & Austausch kombinieren willst | 🔄 Kombibüro |
| dein Unternehmen agil und flexibel arbeitet | 🌐 Open Space Office |
| du mit sensiblen Daten arbeitest | 🔒 Einzel- oder Zellenbüro (Datenschutz) |
| du Fläche effizient nutzen musst | 🏢 Großraum oder Open Space mit Desk-Sharing |
💡 Tipp: Oft ist ein Mix mehrerer Büroformen sinnvoll – hauptsächlich bei größeren Organisationen mit verschiedenen Abteilungen.
Häufig gestellte Fragen zu Büroformen
Basierend auf typischen Nutzeranfragen bei Google & Co. – jeweils mit präziser, praxisnaher Antwort.
Welche 4 Büroformen gibt es?
Häufig wird zwischen Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro und Open Space unterschieden. In der Praxis haben sich jedoch sechs Büroformen etabliert – ergänzt durch Zellenbüro und Kombibüro, die heute besonders relevant sind.
Welche Büroform ist die beste?
Es gibt keine pauschal „beste“ Büroform – entscheidend ist, welche Anforderungen ein Unternehmen hat. Wer Wert auf Konzentration legt, wählt ein Einzel- oder Zellenbüro. Für Teamarbeit sind Gruppen- oder Großraumbüros sinnvoll. Kombibüros bieten einen flexiblen Mittelweg.
Was ist der Unterschied zwischen Großraumbüro und Open Space?
Das Großraumbüro ist ein großer, meist unstrukturierter Raum mit vielen Arbeitsplätzen. Das Open Space Office geht einen Schritt weiter: Es ist in Zonen unterteilt – z. B. Fokus-, Kreativ- oder Kommunikationsbereiche – oft in Kombination mit Desk-Sharing und flexiblem Arbeiten.
Welche rechtlichen Vorgaben gelten für Büroflächen?
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und die technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) regeln unter anderem Mindestfläche pro Arbeitsplatz, Beleuchtung, Raumklima, Schallschutz und Lüftung. Für jedes Konzept gelten dabei teils unterschiedliche Anforderungen.