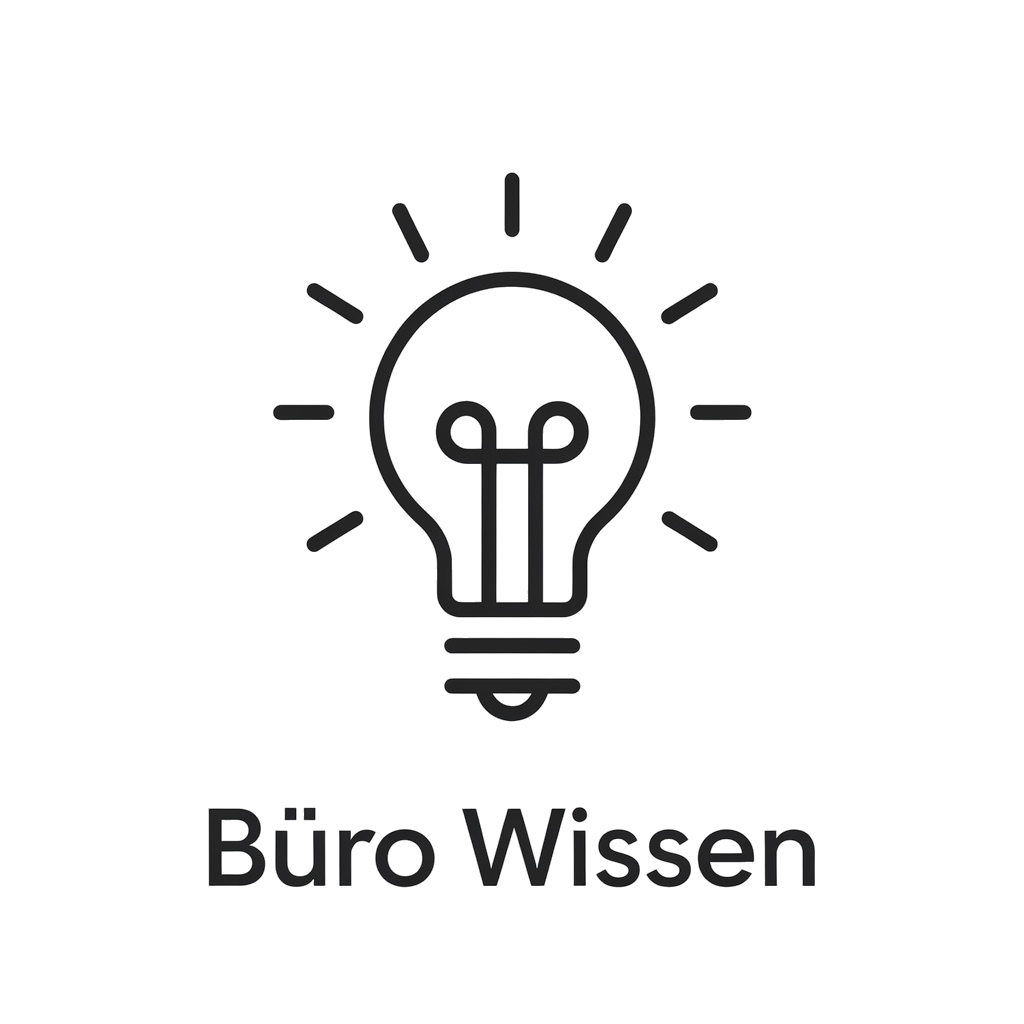Was ist ein Großraumbüro? – Definition & Charakteristika
Ein Großraumbüro ist ein Bürotyp, bei dem viele Arbeitsplätze ohne trennende Wände in einem einzigen, meist sehr weitläufigen Raum untergebracht sind. Typisch ist, dass mehr als zehn Personen gemeinsam in einem offenen Bereich arbeiten – manchmal sogar ganze Abteilungen oder Etagen.
Während moderne Begriffe wie Open Space oder Activity Based Working auf Flexibilität und Zonenmodelle setzen, bleibt das klassische Großraumbüro eher statisch: Jeder hat seinen festen Platz, oft in Reihen- oder Gruppenanordnung, mit eingeschränkter Möglichkeit zum Rückzug.
Charakteristische Merkmale:
- Gemeinsamer Raum für viele Beschäftigte
- Kaum oder keine festen Trennwände
- Einheitliche Möblierung, oft in Reihenschaltung
- Gemeinsame Nutzung von Infrastruktur wie Drucker oder Kaffeemaschine
- Reduzierte Individualisierungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz
Wichtig zur Abgrenzung:
Das Großraumbüro ist nicht gleichzusetzen mit dem Open Space Office, obwohl beide offen wirken. Der Unterschied liegt im Konzept:
- Großraumbüro: starre Struktur, fest zugewiesene Plätze
- Open Space: zoniert, flexibel, dynamisch nutzbar
Gerade in klassischen Verwaltungsstrukturen ist das Großraumbüro bis heute verbreitet – oft aus Platz- und Kostengründen. Doch mit der offenen Fläche gehen auch spezielle Herausforderungen einher: von Lärm über Datenschutz bis zur Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen.
Den kompletten Überblick aller Büroformen gibt es: Büroformen im Vergleich: Welcher Bürotyp passt zu deinem Unternehmen?
Flächenbedarf und Raumgröße im Großraumbüro
Gesetzliche Mindestanforderungen
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) gibt klare Vorgaben für die Mindestgröße von Büroräumen. Im Großraumbüro gelten diese ebenfalls – allerdings mit Besonderheiten, da viele Personen gleichzeitig in einem Raum arbeiten:
- Mindestens 8 m² für den ersten Arbeitsplatz, plus 6 m² für jeden weiteren
- Beispiel: Bei 20 Mitarbeitenden wären das mindestens 122 m²
Das ist jedoch nur das absolute gesetzliche Minimum. Die Technische Regel ASR A1.2 empfiehlt für Großraumbüros deutlich großzügigere Flächen:
Empfohlene Richtwerte laut ASR A1.2:
- 12–15 m² pro Arbeitsplatz als Planungswert
- Inklusive aller Bewegungs- und Verkehrsflächen
Diese höhere Flächenquote ist kein Luxus, sondern notwendig:
- Lärmausgleich: Mehr Abstand reduziert die gegenseitige Störung
- Lüftung & Klimatisierung: Bessere Luftverteilung bei größerem Volumen
- Sicherheitsaspekte: Flucht- und Rettungswege müssen frei bleiben
Raumhöhe
Gerade bei großen Grundflächen ist auch die Raumhöhe wichtig:
- Empfohlen: ≥ 3 Meter, besonders bei Flächen über 100 m²
- In vielen Landesbauordnungen verpflichtend, um Luftqualität und Brandschutz zu gewährleisten
Verkehrswege im Großraum
Die ArbStättV (Anhang 1.8) regelt auch die Breite der Wege:
- Hauptwege: mindestens 1,20 Meter, wenn sie Fluchtwegfunktion haben
- Seitliche Gänge zwischen Schreibtischen: mindestens 0,60 Meter
- Wege dürfen nicht verstellt sein – Kabel, Pflanzen oder Möbel sind keine Ausrede
Ein gut geplantes Großraumbüro beginnt also nicht bei der Einrichtung, sondern bei der sorgfältigen Raumaufteilung – denn zu enge Flächen führen nicht nur zu Unzufriedenheit, sondern können auch arbeitsrechtlich problematisch werden.
Belichtung und Sichtverbindung im Großraumbüro
Anforderungen laut ArbStättV
Die Arbeitsstättenverordnung §3.4 schreibt klar vor:
„Arbeitsräume müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und eine Sichtverbindung nach außen haben.“
Gerade in Großraumbüros, die sich über ganze Etagen erstrecken, ist das eine planerische Herausforderung. Denn Licht dringt nur begrenzt weit in die Tiefe des Raumes ein.
Was heißt das konkret?
- Tageslichtquotient ≥ 2 % (laut ASR A3.4 empfohlen)
- Arbeitsplätze bevorzugt an Fensterfronten
- Sekundärzonen wie Druckerecken, Archivflächen, Meetingbereiche weiter innen
- Keine festen Arbeitsplätze ohne Fensterblick – zumindest nicht dauerhaft zulässig
Praktische Lösungen
- Verglaste Innenräume: Besprechungsräume und Ruhezonen mit Glaswänden lassen Licht durch
- Oberlichter oder Lichtkuppeln: Besonders in tiefen Gebäuden effektiv
- Tageslichtlenkungssysteme: Spezielle Jalousien oder Spiegel helfen, Licht tiefer in den Raum zu bringen
- Blendfreier Sonnenschutz: Automatisierte Rollos oder Lamellen verhindern Blendung durch tiefstehende Sonne
Sichtverbindung: Warum sie wichtig ist
Neben dem Licht geht es auch um das Sichtfeld: Der Blick nach draußen beeinflusst das Wohlbefinden und reduziert psychische Belastung. Wer immer nur auf Wände oder Monitore starrt, ermüdet schneller.
Tipp: Bei Umbauten oder Sanierungen unbedingt darauf achten, dass keine Sichtbarrieren (z.B. hohe Schränke) die Fensterbereiche blockieren.
Lüftung und Raumklima im Großraumbüro
Die Grundlagen: Was muss gewährleistet sein?
Laut ArbStättV Anhang 3.5 und 3.6 gilt:
„Arbeitsräume müssen eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur und ausreichende Luftqualität bieten.“
In Großraumbüros ist das nicht trivial – viele Menschen auf engem Raum erzeugen CO₂, Wärme, Feuchtigkeit und manchmal auch Gerüche.
Anforderungen und Empfehlungen
- Luftvolumenstrom pro Person: mind. 30 m³/h bei leichter Tätigkeit
- CO₂-Konzentration: < 1000 ppm (nach ASR A3.6 empfohlen)
- Temperaturbereich: 20–26 °C (je nach Jahreszeit und Tätigkeit)
- Luftfeuchtigkeit: optimal zwischen 40–60 %
Typische Maßnahmen
- Zentrale Raumlufttechnik (RLT-Anlagen): Ideal für große Flächen
- CO₂-gesteuerte Lüftung: Steuert die Frischluftzufuhr bedarfsgerecht
- Zonale Klimatisierung: Unterschiedliche Temperaturzonen ermöglichen individuelle Anpassungen
- Wartung nach VDI 6022: Pflicht zur Hygieneinspektion der Lüftungsanlagen
Was sonst noch zählt
- Zugluft vermeiden: Luftgeschwindigkeit < 0,2 m/s im Aufenthaltsbereich
- Regelmäßige Kontrolle durch Messung (z.B. CO₂-Monitoring)
- Individuelle Einflussmöglichkeit verbessern: z.B. Fensterlüftung, Temperaturregelung in Zonen, mobile Luftreiniger
Gerade im Sommer ist bei mangelnder Klimatisierung auf alternative Maßnahmen zu achten: Lockerung der Kleidungsvorschriften, Bereitstellung kühler Getränke oder Homeoffice-Flexibilität an heißen Tagen.
Lärmschutz und Raumakustik im Großraumbüro
Warum Lärm im Großraum zum echten Problem werden kann
Großraumbüros bringen naturgemäß eine hohe Geräuschkulisse mit sich: Stimmen, Telefonate, Tastaturgeklapper, Drucker, spontane Besprechungen – all das summiert sich zu einem Dauerlärmpegel, der die Konzentration massiv stören kann.
ASR A3.7 und die ArbStättV Anhang 3.7 verlangen daher:
„Lärm am Arbeitsplatz ist zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“
Für Büroarbeit liegt der empfohlene Grenzwert bei 55 dB(A) – in Großraumbüros werden diese Werte oft überschritten, wenn nicht aktiv gegengesteuert wird.
Bauliche Maßnahmen zur Akustikverbesserung
- Akustikdecken (Absorberklasse A)
- Teppichböden zur Trittschalldämpfung
- Schallschluckende Wandpaneele
- Raumgliederung durch akustisch wirksame Möbel: z. B. Regale, Pflanzen, Glasboxen
DIN 18041 gibt hier wichtige Planungsrichtlinien für Nachhallzeiten und Sprachverständlichkeit.
Organisatorische Maßnahmen
- Zonierung: Trennung von Gesprächszonen (z. B. Projekttische) und Konzentrationszonen
- Verhaltensregeln: Keine spontanen Besprechungen am Platz, Nutzung von Meetingräumen
- Headsets statt Lautsprecher-Telefonie
- Telefonboxen für ruhige Gespräche
- Schichtbelegung bei hoher Auslastung: nicht alle gleichzeitig im Raum
Technische Lösungen
- Sound Masking Systeme: Gleichmäßiges „White Noise“, das störende Geräusche überdeckt
- Lichtsignale für Telefon statt Klingelton
- Akustikmessung & Monitoring: hilft, problematische Zonen zu identifizieren
Ergonomie und Bildschirmarbeitsplätze im Großraumbüro
Was ergonomisch besonders herausfordernd ist
In Großraumbüros arbeiten viele Menschen eng nebeneinander, oft mit gleichen Möbeln, aber unterschiedlichen Anforderungen. Genau hier liegt die Herausforderung: Jeder Arbeitsplatz muss individuell ergonomisch anpassbar sein – obwohl er Teil einer standardisierten Großstruktur ist.
Gemäß ASR A6 „Bildschirmarbeit“ und Anhang 6 ArbStättV gilt:
„Arbeitsplätze an Bildschirmgeräten müssen so gestaltet sein, dass Gesundheit und Sicherheit nicht gefährdet werden.“
Anforderungen an Möbel und Technik
- Höhenverstellbare Stühle mit Lordosenstütze und Synchronmechanik
- Tische mit Mindesttiefe 80 cm, besser mehr – für Monitorabstand und Handauflagen
- Externe Monitore mit höhenverstellbarer Halterung
- Gute Beleuchtung ohne Blendung auf dem Bildschirm
- Individuell einstellbare Arbeitsbereiche, auch bei Desk-Sharing
Bildschirmarbeitsplätze im Detail
- Blendfreiheit: keine Spiegelungen durch Fenster oder Leuchten
- Monitorposition: Augenhöhe, Abstand ca. 50–70 cm
- Maus & Tastatur: ergonomisch platziert, ausreichend Platz für Handballen
- Pausenmanagement: Arbeit am Bildschirm muss durch regelmäßige Unterbrechungen aufgelockert werden – z. B. kurze Wechselaufgaben, Aufstehen, Gehen
Bewegung fördern trotz Sitztätigkeit
- Drucker bewusst abseits platzieren
- Stehtische für kurze Meetings oder informellen Austausch
- Wege schaffen (z. B. Kaffeemaschine nicht in Schreibtischnähe)
Auch ein Bewegungskonzept kann Teil der Gefährdungsbeurteilung sein: Ziel ist es, Belastungen durch Dauersitzen und einseitige Haltung aktiv zu reduzieren.
Datenschutz und Sichtschutz im Großraumbüro
Datenschutz: Ein sensibles Thema auf offener Fläche
Großraumbüros bringen nicht nur Lärm und Ablenkung mit sich, sondern auch erhöhte Risiken für den Datenschutz. Viele Mitarbeitende arbeiten eng beieinander – und damit steigt die Gefahr, dass vertrauliche Daten unbeabsichtigt eingesehen oder mitgehört werden.
Laut DSGVO-Artikel 32 müssen technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um unbefugte Einsichtnahme zu verhindern.
Wichtige Maßnahmen für die Datenschutz-Compliance
- Blickschutzfolien auf Monitoren, insbesondere bei sensiblen Tätigkeiten
- Clean-Desk-Policy konsequent umsetzen: Keine Unterlagen offen liegen lassen
- Sichere Schränke oder abschließbare Rollcontainer für persönliche Dokumente
- IT-Sicherheit durch automatische Bildschirmsperre bei Inaktivität
- Zonierung nach Sensibilität: HR, Buchhaltung oder Rechtsabteilung nach Möglichkeit räumlich trennen oder abschirmen
- Besprechungsräume oder Telefonboxen für sensible Gespräche nutzen
- Zutrittskontrolle: Großraumbereiche nur für berechtigte Personen zugänglich
Schulung und Awareness
Datenschutz im Büroalltag beginnt bei jedem Einzelnen. Daher sollte der Arbeitgeber:
- Regelmäßige Mitarbeiterschulungen anbieten
- Klare Verhaltensrichtlinien formulieren
- Datenschutz in die Gefährdungsbeurteilung integrieren
Tipp: Auch scheinbar kleine Maßnahmen wie Sichtschutzstreifen an Monitoren oder Desk-Sharing-Regeln mit Clean-Desk-Pflicht erhöhen das Datenschutzniveau spürbar.
Allgemeiner Arbeitsschutz im Großraumbüro
Großraum = Großes Risiko?
In Großraumbüros arbeiten viele Menschen auf engem Raum – das bedeutet vielfältige Belastungen für Körper und Psyche. Von Lärm über Licht bis hin zu sozialer Dichte: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, all diese Aspekte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung systematisch zu prüfen (§ 5 ArbSchG, § 3 ArbStättV).
Physische Belastungen: Alles auf einen Blick
- Beleuchtung: Muss ausreichend, blendfrei und an die Sehaufgaben angepasst sein (ASR A3.4)
- Raumklima: Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemäß ASR A3.5/3.6 (idealerweise 20–26 °C, 40–55 % r.F.)
- Lärmschutz: Einhaltung der Richtwerte < 55 dB(A) für konzentriertes Arbeiten (ASR A3.7)
- Bewegungsflächen: Mindestmaße für Verkehrswege und Arbeitsplatzumfeld einhalten (ASR A1.2/A1.8)
- Bildschirmarbeitsplätze: Ergonomisch gestaltet, höhenverstellbar, ausreichend Platz (ASR A6)
Psychische Belastungen: Nicht zu unterschätzen
- Ständige Ablenkung durch Gespräche, Geräusche und visuelle Reize
- Fehlende Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten oder kurze Pausen
- Gefühl von Überwachung oder sozialer Dichte
- Unklare Kommunikationsregeln (wer spricht wann wo mit wem?)
Diese Aspekte gehören verpflichtend in die psychische Gefährdungsbeurteilung – viele Unternehmen setzen hier auf Mitarbeiterbefragungen, moderierte Workshops oder individuelle Arbeitsplatzanalysen.
Maßnahmen für gesünderes Arbeiten im Großraum
- Rückzugsräume oder „Silent Zones“
- Hybride Arbeitsmodelle mit Homeoffice-Tagen
- Verhaltensregeln zu Kommunikation und Lärm
- Raumzonen für unterschiedliche Arbeitsarten (z. B. Fokus, Dialog, Kreativität)
- Förderung aktiver Pausen und Bewegungsangebote
Ein gut geplanter Großraum kann funktionieren – aber nur, wenn er flexibel, sozialverträglich und gesundheitlich sicher gestaltet wird.
Großraumbüro: Für wen lohnt sich diese Büroform?
Das klassische Großraumbüro ist ein effizienter Raumtyp, aber nicht ohne Herausforderungen. Es eignet sich besonders für standardisierte Prozesse mit engem Teamkontakt – erfordert aber gezielte Planung, klare Spielregeln und starken Gesundheitsschutz.
👍 Besonders geeignet für …
- Kundenservice-Teams oder Support-Abteilungen mit hoher Abstimmung
- Projektgruppen mit enger Zusammenarbeit
- Unternehmen mit festen Arbeitszeiten und strukturierter Büropräsenz
⚠️ Nur bedingt geeignet für …
- Abteilungen mit vertraulichen Aufgaben (HR, Finanzen, Recht)
- Kreative oder wissensintensive Tätigkeiten mit hohem Fokusbedarf
- Organisationen mit hoher Homeoffice-Quote
🧩 Erfolgsfaktoren:
- Hochwertige Akustik- und Klimasteuerung
- Zonierung für unterschiedliche Tätigkeiten (Fokus vs. Kommunikation)
- Ergonomische Standards für alle Plätze
- Datenschutzmaßnahmen wie Clean-Desk-Regeln und Sichtschutz
Unser Fazit:
Ein Großraumbüro funktioniert nur, wenn es konsequent auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist, die darin arbeiten. Technische Ausstattung, Raumdesign und Unternehmenskultur müssen dabei Hand in Hand gehen – sonst wird aus Effizienz schnell Belastung.
Brandschutz im Großraumbüro
Viele Menschen – hohe Verantwortung
Großraumbüros gelten brandtechnisch als besonders kritisch: große Flächen, offene Strukturen, hohe Personendichte. Daraus ergeben sich verschärfte Anforderungen an den baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutz – gesetzlich geregelt u. a. durch die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Landesbauordnungen und die ASR A2.2 / A2.3.
Das sind die wichtigsten Brandschutz-Anforderungen
- Zweiter Fluchtweg: Großraumbüros > 400 m² benötigen zwei unabhängige Ausgänge (ASR A2.3)
- Mindest-Fluchtwegbreiten: Abhängig von Personenzahl – z. B. 1,20 m bis 200 Personen, darüber breiter oder gestaffelt
- Maximale Fluchtweglänge: < 35 m in Luftlinie zum nächsten Ausgang (ggf. kürzer bei erhöhtem Risiko)
- Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung: Pflicht bei Fluchtwegen ohne Tageslicht oder mit Hindernissen
- Feuerlöscher: Mindestens alle 200 m² ein Löscher, ggf. Wandhydranten bei sehr großen Flächen
- Brandmeldeanlage: Empfohlen bei hoher Personenzahl – automatische Detektion und Alarmierung
- Baulicher Brandschutz: Schwer entflammbare Materialien (DIN 4102 B1), feuerhemmende Türen (z. B. T30), Rauchabschnittsbildung
- Brandschutzorganisation: Benennung von Brandschutzhelfern (1 je 20 Personen), Aushänge der Brandschutzordnung Teil B, Evakuierungsübungen
Typische Schwachstellen im Großraumbüro
- Zu enge Möbelanordnung: versperrt Fluchtwege
- Fehlende Sichtachsen: erschwert Orientierung im Alarmfall
- Fehlender Rauchschutz bei offenen Meetingzonen
- Keine akustische oder optische Alarmierung bei hoher Lautstärke
Im Ernstfall entscheidet jede Sekunde. Der Brandschutz im Großraumbüro muss deshalb nicht nur normkonform, sondern realitätsnah durchdacht und regelmäßig geprobt sein.
FAQ zum Thema Großraumbüro
Was ist ein Großraumbüro?
Ein Großraumbüro ist ein großer, offener Raum mit mehreren Arbeitsplätzen ohne feste Abgrenzung – meist für mehr als zehn Personen.
Welche Vorteile bietet ein Großraumbüro?
Es ermöglicht schnelle Kommunikation und effiziente Flächennutzung – ist aber auch anfällig für Lärm und Stress.
Wie viel Platz braucht ein Arbeitsplatz im Großraumbüro?
Empfohlen sind 12–15 m² pro Arbeitsplatz, um Lärm- und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Wie wird Lärmschutz im Großraumbüro umgesetzt?
Durch Akustikdecken, Zonierung, Verhaltensregeln und ggf. Geräuschmaskierung.
Was gilt für den Datenschutz im Großraumbüro?
Sichtschutz, Clean-Desk-Regeln, Zutrittskontrolle und sensibler Umgang mit Gesprächen sind Pflicht – gemäß DSGVO.
Wo finde ich die Gesetzestexte zum Open Office?
Zu den rechtlichen Details:
• Büroflächen richtig berechnen (ASR A1.2)
• Schallschutz & Akustik im Büro (ASR A3.7, DIN 4109)
• Datenschutz im Büroalltag (DSGVO & Sichtschutz)
• Arbeitsschutz im Büro (ArbStättV & ArbSchG)